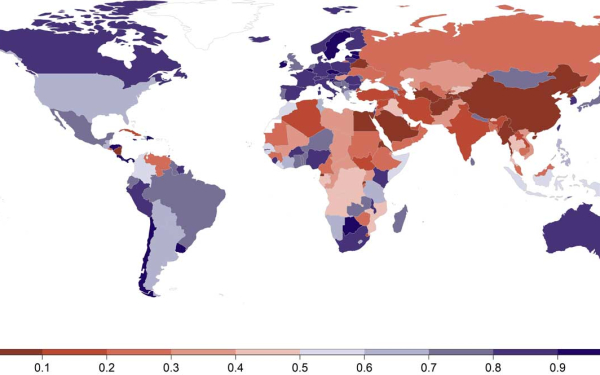Donatello Trisolino - pexels
"Wir können nicht vorhersagen, ob die Demokratie hält"
#DemokratieDeutschland ist mittendrin im Strudel globaler Krisen und Konflikte. Rechtspopulisten freuen sich über wachsenden Zuspruch. Und von der neuen Bundesregierung werden viele Lösungen erwartet. Und zwar schnell! Ein Gespräch zwischen dem Soziologen Steffen Mau und Georg Schütte, Vorstand der VolkswagenStiftung, über das Ende der "Schönwetterdemokratie" (Mau) und den Aufbruch ins Ungewisse.
Herr Mau, können die etablierten Parteien die Erwartungen der Öffentlichkeit überhaupt noch erfüllen?
Prof. Dr. Steffen Mau: Die Öffentlichkeit ist stärker als früher geprägt durch Emotionen und Gefühlsschwankungen, und die Parteien reagieren darauf mit Affektpolitik. Die Bindung an Parteien und die Orientierung an deren Programmatik schwindet zugunsten einer Stimmungs- und Erwartungsdemokratie. Die Politik soll bestimmte Leistungen erbringen, bestimmte Dinge tun. Wenn sie nicht liefert, wendet man sich anderen Parteilagern zu. Am deutlichsten ließ sich das zuletzt am Wahlverhalten der Unter-25-Jährigen erkennen: 2021 wählten sie mehrheitlich Grüne und FDP, diesmal Linke und AfD. Das lässt sich nicht erklären durch einen tiefgreifenden Wandel grundlegender politischer Orientierungen.
Dr. Georg Schütte: All das muss man vor dem Hintergrund verlorengegangener internationaler Gewissheiten sehen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, Trumps Wiederwahl, der Aufstieg rechter und rechtspopulistischer Parteien und Positionen von Ungarn über Italien und Frankreich bis eben in die USA: Das verändert die politischen Trends auch in Deutschland.
Mau: Dahinter steckt eine generelle Destabilisierung der alten politischen Ordnung, mit veränderten Regeln und mit wachsenden Möglichkeiten für neue Akteure, politische Geländegewinne zu erzielen. Im Moment können wir nicht richtig vorhersagen, wohin der Druck auf die demokratischen Institutionen führt, ob sie standhalten werden. Die Bundesrepublik war, das muss man so sagen, die meiste Zeit über eine Schönwetterdemokratie, mit der Koexistenz einer positiven wirtschaftlichen und einer demokratischen Entwicklung. Wenn die wirtschaftlichen Verteilungsspielräume weiter schwinden und sich ökonomische Unsicherheiten ausbreiten, bleibt abzuwarten, ob die Menschen bei der Stange bleiben oder in noch größeren Scharen zu den Populisten überlaufen.
Schütte: Die Frage, welche Zukunft die Demokratie hat als Organisationsform für unser Staatswesen und für unsere Gesellschaft, treibt uns als Stiftung um. Darum haben wir vor zwei Jahren ein Förderangebot aufgelegt zur Demokratieforschung. Das ist eine Herausforderung. Wir arbeiten als Wissenschaftsförderorganisation erkenntnisorientiert, die Umsetzung von Erkenntnis in politisches Handeln gehört eigentlich nicht zu unserer Aufgabe.

Prof. Dr. Steffen Mau ist Soziologe und hält die Professur für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin.
Deshalb versuchen wir einen Zwischenweg zu gehen und füllen eine Leerstelle, die wir identifiziert haben. Indem wir transdisziplinäre Forschung ermöglichen, also Forschungsprojekte, die Wissenschaftler verschiedener Fächer zusammenbringen mit Akteuren aus verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft. In der Erwartung, dass wissenschaftliche Erkenntnis so gesellschaftliche Handlungswirksamkeit erzielen kann.
Die Bundesrepublik war die meiste Zeit über eine Schönwetterdemokratie, mit der Koexistenz einer positiven wirtschaftlichen und einer demokratischen Entwicklung.
Im Vorfeld der Landtagswahlen in Ostdeutschland waren auch bei uns die Sorgen groß: Was passiert da gerade, und was können wir tun? Herr Mau hat uns damals in einem Impulsvortrag auf die Bedeutung von Bürgerräten hingewiesen, deren Einrichtung helfen könnte, politisches Vertrauen zurückzugewinnen. Als Wissenschaftsförderer können wir die zwar nicht finanzieren, wir können aber die Begleitforschung zu ihrer Wirksamkeit unterstützen.
Fürchten Sie nicht den Vorwurf von politischem Aktionismus?
Schütte: Wir hatten dazu engagierte Debatten in der Stiftung: Wenn wir betroffene gesellschaftliche Akteure zum Partner im Forschungsprozess machen, ist dann nicht die Erkenntnis von Beginn an gesetzt, nämlich deren jeweilige politische oder gesellschaftspolitische Agenda? Und wird Forschung dann zur reinen Bestätigungsforschung? Wir habe das Risiko aufgegriffen und erwarten von den Projekten, dass sie Interessen und Rollen der zivilgesellschaftlichen Akteure im Forschungsprozess thematisieren und bestimmen, damit tatsächlicher Erkenntnisgewinn und Transferrelevanz gelingen können.
Herr Mau, warum haben sich gerade in Ostdeutschland so viele Menschen von den traditionellen Parteien abgewandt, dass es in vielen Regionen nur noch eine Volkspartei gibt, und die heißt AfD?

Dr. Georg Schütte ist Vorstand der VolkswagenStiftung.
Mau: Die aus meiner Sicht zu einfache Antwort würde lauten, dass die älteren Ostdeutschen in einer Diktatur sozialisiert wurden und nie richtig in der Demokratie angekommen sind. Ich bestreite nicht, dass das Aufwachsen im Staatssozialismus bis heute einen Effekt auf die Politik hat, weil autoritäre Denkmuster weiterbestehen. Aber wenn wir uns die jüngsten Wahlergebnisse anschauen, dann waren es wie erwähnt die Jungen, nicht die Alten, die besonders stark die AfD gewählt haben, während unter den älteren Ostdeutschen bei der Bundestagswahl die CDU die stärkste Partei war. Die Sache ist also komplizierter. Zu der DDR-Erfahrung kommen die gesellschaftlichen Transformationsschäden der 90er Jahre, aber auch die reichen als Erklärung nicht aus. Ausschlaggebend sind für mich auch die weiter bestehenden enormen sozialstrukturellen und demografischen Unterschiede zwischen Ost und West.
Die sich wie äußern?
Mau: Das Stadt-Land-Gefälle ist viel größer. Ich würde behaupten, dass ostdeutsche Groß- und Universitätsstädte gar nicht mehr so anders sind als Hannover oder Göttingen. Die kleinen und mittleren Städte und die ländlichen Räume aber sind es, also die Abwanderungsregionen, in denen eine andere politische Kultur herrscht als in den Regionen mit Wachstum, mit Zuwanderung. Diese andere Kultur koppelt sich mit der ausgeprägten Schwäche der etablierten demokratischen Parteien in Ostdeutschland, die ich als „Bonsai-Organisationen“ bezeichne, weil sie so wenig Mitglieder haben und kaum noch in der Lage sind, den politischen Diskurs mitzugestalten. Auch diese Schwäche ist nicht über Nacht entstanden, sondern zurückzuführen auf den Zusammenbruch des sozialen Gefüges in den 90er Jahren, auf eine kaum vorhandene Zivilgesellschaft, die es in der DDR nicht gab und die danach nie richtig wachsen konnte. Da sind offene Räume entstanden, und in die sind rechtsgerichtete Akteure bewusst hineingestoßen mit ihren Netzwerken, Vereinen und Vorfeldorganisationen.
Wozu führte das?
Mau: Ich war neulich in Bautzen und habe mich mit Leuten getroffen, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen. Das Bedrückende ist, wie allein auf weiter Flur sie agieren müssen. Die breite gesellschaftliche Mitte hat sich aus dem politischen Raum zurückgezogen, aus Angst vor der Härte und starken Konfrontativität der Auseinandersetzung. Es bleibt eine recht kleine Zivilgesellschaft, die anders strukturiert ist als im Westen, wo die Mitgliedschaft in Kirchen, Gewerkschaften und Vereinen bedeutsamer ist. Der Osten bleibt also anders, andererseits gewinnt die AfD auch im Westen an Einfluss. Man könnte sagen: Der Abstand zwischen den Landesteilen bleibt, aber das Niveau verschiebt sich deutschlandweit immer weiter nach rechts.
Anstatt uns also zwischen Ost und West wechselseitig zu entrüsten und dadurch voneinander zu entfremden, sollten wir an unserer Dialogfähigkeit arbeiten, gemeinsam nach Sachlösungen suchen.
Schütte: Währenddessen erleben wir im Westen etwas, das ich Ernüchterungsdiskurs nennen möchte. Es gab Demonstrationen gegen Rechts, die ein öffentliche Signal zur Verteidigung der Demokratie sein sollten. Und dann fuhr die AfD auch im Westen Rekordergebnisse ein, in Gelsenkirchen etwa lag sie bei rund 25 Prozent, doppelt so hoch wie 2021. Womöglich weil es auch im Westen Regionen gibt, in denen sich die Menschen abgehängt fühlen. Anstatt uns also zwischen Ost und West wechselseitig zu entrüsten und dadurch voneinander zu entfremden, sollten wir an unserer Dialogfähigkeit arbeiten, gemeinsam nach Sachlösungen suchen. Allerdings ohne dabei in antidemokratische oder rechtspopulistische Positionen zu verfallen, wo Freiheitsrechte eingeschränkt werden und Menschenrechte nicht mehr zum Zuge kommen. Diesen Dialog hinzubekommen, der das eine leistet, ohne das andere über Bord zu werfen, halte ich für unsere größte politische Herausforderung.
Herr Mau, haben zu viele Menschen im Osten ein Demokratiedefizit?
Mau: Der Begriff "Demokratie" ist wahrscheinlich nicht der Richtige in dem Zusammenhang. Die allermeisten Menschen in Deutschland, im Osten sogar mehr als im Westen, sagen, die Demokratie sei eine unterstützenswerte Staatsform. Doch die Vorstellungen, was man damit meint, unterscheiden sich. Im Westen ist das Verständnis an die Verfahren der repräsentativen Demokratie und einer parlamentarischen Ordnung geknüpft. Im Osten dagegen denken viele an einen unmittelbaren, unbedingten, ja homogen gedachten Volkswillen, der sich artikulieren soll. Das kann man kritisch sehen, aber es ist eine Gegebenheit, mit der man irgendwie umgehen muss.
Wie das?
Mau: Studien zeigen: Wenn die Leute direkt mitentscheiden können, wenn sie sich zusammensetzen, wenn sie ein konkretes politisches Problem bearbeiten, dann werden die Hassgefühle und Ressentiments eingehegt und heruntergedimmt. Wir müssen den Leuten also Dinge an die Hand geben, mit denen sie in ihrem Alltag demokratische Selbstwirksamkeit erfahren können. Und wir müssen stärker auf die Jugend schauen, deren politische Sozialisation nicht mehr in Parteien stattfindet, nicht mehr in Jugendverbänden, der Jungen Gemeinde oder anderen organisierten Formen. Sondern über die sozialen Medien wie YouTube, Instagram oder TikTok, wo rechte Influencer eine große Reichweite haben. Auch das ist übrigens im Westen nicht anders.
Während Soziologen wie Steffen Mau warnen, appellieren und Reformvorschläge machen, agieren die traditionellen Parteien verunsichert und fahren einen programmatisch-kommunikativen Zickzack-Kurs. Kommt es Ihnen auch so vor, als seien wir Zeugen eines Unfalls in Zeitlupe, Herr Schütte? Die Demokratie fährt gegen die Wand, und wir schauen zu?
Schütte: Als Staatsbürger habe ich das immer stärkere Gefühl, dass wir unbedingt handeln müssen, und zwar sofort. Als Vertreter der VolkswagenStiftung sage ich: Wir tun, was wir können und wofür wir mandatiert sind. Wir können einen Beitrag dazu leisten, die Phänomene unserer Demokratiekrise zu reflektieren. Wir können mit den entsprechenden Formaten die Wissenschaft in den Austausch mit der Gesellschaft hineinholen. Doch wir sollten nicht überreagieren. Wir wären als Stiftung heillos überfordert, wir könnten nur scheitern, wenn wir als gesellschaftlicher Reparaturbetrieb fungieren wollten.
Mau: Sie haben vollkommen Recht. Sie können als Stiftung nicht gleichzeitig Wissenschaftsförderer und politischer Akteur sein. So, wie man als Wissenschaftler gleichzeitig Bürger ist, aber die Rolle als Wissenschaftler nicht zu stark politisieren sollte. Das ist immer eine Gratwanderung, vor allem für einen Soziologen, der nicht zu Mikroben oder Biochemie forscht, sondern zu Dingen, die die Gesellschaft selbst betreffen. Hier muss ich als Wissenschaftler die Rollen immer wieder klarziehen. Eine zu stark politisierte Wissenschaft würde sich selbst delegitimieren. Sie würde bei denen, die die Wissenschaft ohnehin kritisch sehen, noch stärker in den Verdacht geraten, nur eine politische Agenda zu verfolgen. Wenn die wissenschaftliche Autorität untergraben ist, verliert sie ihren Einfluss.
Ist die Angst von Wissenschaftlern, sich dem Aktivismusvorwurf auszusetzen, nicht überholt, wenn schon das Zitieren wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse an sich als Linksaktivismus denunziert wird?
Mau: Das muss man in der Tat zurückweisen. Über die Frage der Wissenschaftlichkeit hat weder die Politik noch die Laienöffentlichkeit zu befinden. Aber: Je stärker Sie als Wissenschaftler Agenda-Setting betreiben, desto mehr Reaktanz erzeugen Sie. Darum wäre ich da eher zurückhaltend.
Es gibt in Deutschland immer noch eine bemerkenswerte zivilgesellschaftliche Stärke und demokratische Resilienz.
Sie argumentieren trotz der politischen Situation vor allem in Ostdeutschland erstaunlich entspannt, Herr Mau. Oder täuscht der Eindruck?
Mau: Ich bin als Wissenschaftler immer wieder Bedrohungen ausgesetzt. Ich erhalte Hassmails, ich werde auf der Straße angegangen, obwohl ich meine, mich relativ moderat und wissenschaftlich vielfach abgesichert in der Öffentlichkeit zu äußern. Die Vorstellung, dass irgendwann Universitäten in einem Bundesland unter einem Wissenschaftsminister agieren müssten, der eine antiliberale Gesinnung hat, finde ich extrem beunruhigend. Wir sehen gerade in den USA, wie schnell die Wissenschaftsfreiheit fundamental in Frage gestellt werden kann und damit die Integrität der Wissenschaft insgesamt. Wir dürfen uns aber nicht ins Bockshorn jagen lassen, nicht in Angststarre verfallen. Es gibt in Deutschland immer noch eine bemerkenswerte zivilgesellschaftliche Stärke und demokratische Resilienz, die wir noch gar nicht ausmobilisiert haben.
Sie sind für Deutschland tatsächlich optimistischer als für die USA?
Mau: Wir haben die kurzfristig auf die Beine gestellten Demonstrationen im vergangenen Jahr mit mehreren hunderttausend Menschen gesehen, davon würde noch viel mehr kommen, wenn die Grundprinzipien unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung fundamental angegriffen würden. Meine Zuversicht, dass es bei uns eine stärkere Gegenwehr geben würde, speist sich auch aus der deutschen Geschichte mit ihren zwei Diktaturerfahrungen. Während die USA ein Land sind, das trotz seiner langen Demokratiegeschichte bislang nie die Erfahrung machen musste, dass eine Demokratie in eine Diktatur kippen kann.
Herr Schütte, teilen Sie den Optimismus von Steffen Mau, dass die deutsche Zivilgesellschaft resilienter auf eine Bedrohung ihrer Freiheit reagieren würde als die amerikanische?
Schütte: Ich teile die Einschätzung von Herrn Mau. Inzwischen besuchen gut 50 Prozent eines Altersjahrgangs in Deutschland die Hochschule. In den USA haben wir eine viel ausgeprägtere soziale Spaltung. Ein Drittel der Gesellschaft genießt dort einen extrem hohen Lebensstandard, vergleichbar mit dem der Schweiz, samt hervorragender Kranken-und Altersversorgung und dem Zugang zu herausragenden Universitäten. Ein weiteres Drittel lebt auf einem Stand, wie er in Kontinentaleuropa üblich ist, und besucht, je nach Begabung und Neigung, Hochschulen vergleichbar den europäischen. Das letzte Drittel dagegen ist in fast jeder Hinsicht abgehängt. Das ermöglicht einen Anti-Eliten-Diskurs, der in Deutschland dank der über Jahrzehnte abgelaufenen Bildungsexpansion meines Erachtens in der Dimension nicht denkbar ist.
Mau: Es hat mich schon verblüfft, wie gering in den USA der öffentliche Aufschrei war, als Wissenschaftler und Universitäten von der Regierung frontal angegriffen wurden. Viele sind lieber in Deckung gegangen, um nicht selbst den Beschuss der Trump-Administration auf sich zu ziehen. Man kann ähnliche Effekte in Deutschland nie ausschließen. Offensichtlich steckt in der menschlichen Natur ein grundlegender Opportunismus, der sehr früh zum Tragen kommt, noch bevor die Bedrohungen für die Mehrheit real wird.
Es braucht eine politische Programmatik, die eine Vision beinhaltet, aber auch das Potenzial ihrer Umsetzbarkeit in sich trägt.
Was wünschen Sie sich von der neuen Bundesregierung, Herr Mau?
Mau: Ich hätte da einen ganzen Blumenstrauß an Wünschen. Am wichtigsten ist, dass sie der Inflation partikularistischer Ansprüche, angeheizt durch die neuen Finanztöpfe, widersteht und stattdessen eine wirkliche Programmatik für einen Modernisierungsschub erkennen lässt. Anstatt nur irgendwelche Begehrlichkeiten abzudecken, sollte sich die Politik auf die Lösung der Probleme konzentrieren, die am meisten Leute beschäftigen, auf eine kompetente und sachbezogene Art. Nehmen Sie das Thema Migration. In Umfragen liegt es zuweilen nur auf Platz 10 der wichtigsten Probleme. Als Mitglied im Sachverständigenrat für Migration und Integration habe ich an verschiedenen Berichten mitgewirkt, die leider von der Politik relativ wenig wahrgenommen wurden. Sie zeigen ein Gesamtbild, das nicht so düster und dunkel aussieht, wie mancher glaubt, weder bei der Arbeitsmarktintegration noch bei der Kriminalität. Umgekehrt gibt es die Erfolgsgeschichten der Migrationsgesellschaft. Während manche Spitzenpolitiker behaupten, die Geflüchteten würden nach Deutschland kommen, um sich hier die Zähne machen zu lassen, ist die Realität so, dass 30 Prozent unserer Ärztinnen und Ärzte eine Migrationsbiografie haben. Und ohne diese 30 Prozent bekäme man noch viel weniger Arzttermine.
Schütte: Das gilt für die Überhöhung einer angeblichen Migrationskrise und es gilt auch für die Überbetonung von Anliegen wie dem Gendern und Debatten über ein drittes Geschlecht. Das war in den USA ein willkommenes Einfallstor für Rechtspopulisten, die den Demokraten, Stichwort Wokeness, vorgeworfen haben, sie hätten sich von den sogenannten normalen Leuten entfremdet.
Mau: Ich bin kein Verfechter der These, der Aufstieg der Rechten sei nur eine Reaktion auf die Wokeness des linksliberalen Milieus. Aber Politik muss sichtbare, tangible Probleme lösen: die Wohnungsnot, die Inflation, die Alterssicherung. Sie muss, grundsätzlicher, die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung in der digitalen Welt wiederherstellen, das Funktionieren des öffentlichen Nahverkehrs. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hat einmal gesagt, das Zu-Spät-Kommen der Deutschen Bahn sei auch ein Demokratieproblem. So ist es: Wenn die Leute das Gefühl haben, die öffentlichen Institutionen versagen bei der Erfüllung ihrer Kernaufgaben, dann wenden sie sich ab.
Schütte: Es braucht eine politische Programmatik, die eine Vision beinhaltet, aber auch das Potenzial ihrer Umsetzbarkeit in sich trägt. Den großen Wurf denken, die dafür nötigen Einzelinstrumente entwickeln, ohne sich in Details zu verfangen, das wird die Herausforderung sein.