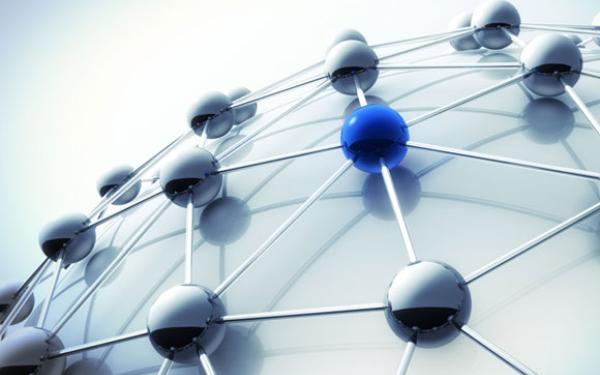Yauhen - stock.adobe.com
Wie Forschende aus der Ukraine und Russland kooperieren
Als Instrument der "Science Diplomacy" schrieb die Stiftung 2014 das Förderprogramm "Trilaterale Partnerschaften" aus. Eine Zwischenbilanz.
Seit Anfang 2014 schwelt die Ukraine-Krise: Die Krim wurde von Russland annektiert und im Donbass haben sich ukrainische Truppen und pro-russische Separatisten in einem schier endlosen Stellungskrieg verkeilt. Warum, so kann man sich getrost fragen, startet die VolkswagenStiftung inmitten dieses Tumults, Ende 2014, ein Förderangebot, das das scheinbar Unmögliche zum programmatischen Kern erklärt: Für die Ausschreibung "Trilaterale Partnerschaften" können sich deutsche, ukrainische und russische Forscherinnen und Forscher nur bewerben, sofern sie zusammen an einem gemeinsamen Projekt arbeiten möchten.
Ein Wagnis unberechenbaren Ausgangs
Wie soll das funktionieren: neben den deutschen Partnern zwei weitere zur Zusammenarbeit zu nötigen, deren Herkunftsländer sich gerade tief verfeindet begegnen? "Das war gewiss ein Wagnis", sagt Dr. Matthias Nöllenburg, der die "Trilateralen Partnerschaften" von Anfang an als Förderreferent begleitet, "aber Risikobereitschaft zählt zu den Kernmerkmalen der Stiftung." Als unabhängige, nichtstaatliche Förderorganisation könne die VolkswagenStiftung gerade in Konfliktlagen eine unparteiische Vermittlungsrolle einnehmen.
"Wir begreifen die grenzüberschreitende Wissenschaftsförderung als einen Baustein zur internationalen Verständigung. Den Dialog zwischen den Fachwissenschaften aufrecht zu erhalten, auch unter politisch widrigen Verhältnissen, ist unsere Auffassung von Science Diplomacy. Anders gelingen weder Vertrauensaufbau noch Wiederannäherung." Nöllenburg kann das besonders gut beurteilen: Er ist neben den "Trilateralen Partnerschaften" für ein weiteres Programm in einer konfliktreichen Region verantwortlich: der schon seit 2000 laufenden Förderinitiative "Zwischen Europa und Orient – Mittelasien/Kaukasus im Fokus der Wissenschaft".

Dr. Matthias Nöllenburg betreut als Förderreferent u. a. die Angebote "Trilaterale Partnerschaften" und "Zwischen Europa und Orient – Mittelasien/Kaukasus im Fokus der Wissenschaft"
Politische Interventionen zur Abschreckung
Für die "Trilateralen Partnerschaften" gab das Kuratorium der Stiftung im November 2014 grünes Licht – und der politische Widerspruch ließ nicht lange auf sich warten: Das ukrainische Bildungsministerium ermahnte die eigenen Forscherinnen und Forscher, sich auf keinen Fall mit russischen Kolleginnen und Kollegen zusammenzutun; deshalb solle man das Förderangebot der VolkswagenStiftung strikt ignorieren. Auf das Verdikt aus Kiew folgten diplomatische Konsultationen, die am Ende zu einer Abmilderung des Banns führten – und der Stiftung über 200 Projektanträge bescherten, weit mehr als erwartet. Nach der Begutachtung wurden zur Jahreswende 2015/16 37 Forschungsvorhaben und zwei Tagungen mit 8,8 Mio. Euro an Fördergeldern bewilligt.
Wie erklärt sich Matthias Nöllenburg die große Resonanz?
"Zum einen war die Ausschreibung fach- und themenoffen, bot also allen Disziplinen einen Anknüpfungspunkt. Zum anderen kannten sich manche Teams schon aus langjähriger Zusammenarbeit. Ein Drittel der Partner aus Deutschland sind in der Ukraine oder Russland geboren. Diese Konsortien wollten ihre vielversprechenden Arbeiten fortführen, allen politischen Widerständen zum Trotz." Es hätten sich durch die Ausschreibung aber auch ganz neue personelle Konstellationen und Forschungsansätze ergeben. Ein Blick auf die Fächerverteilung der bewilligten Anträge: 21 waren den Naturwissenschaften inklusive Mathematik und Informatik zuzurechnen, acht den Lebenswissenschaften und zehn den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften.

Teilnehmende beim Statussymposium in Radebeul
Politik ist das eine, Wissenschaft das andere
Und wie haben die Kooperationen in der Praxis funktioniert? Nöllenburg hat mehrere Projekte in Deutschland und der Region besucht – und war beeindruckt von dem stets respektvollen und freundschaftlichen Umgang aller Beteiligten miteinander. Besonders das Statussymposium in Radebeul bei Dresden im Mai 2019 mit 170 Geförderten war für ihn ein Indikator für den Erfolg des grenzüberwindenden Ansatzes der Ausschreibung: "In den Diskussionen wurden Fachfragen thematisiert, politische Überzeugungen spielten keine Rolle."
Da Reisen zwischen der Ukraine und Russland oftmals nur schwer zu organisieren sind, und die Forscherinnen und Forscher ihre linientreuen Universitäten und Akademien nicht unnötig herausfordern wollten, traf man sich zum Austausch häufig auf neutralem Terrain: außer in Deutschland noch in Weißrussland, Armenien, der Slowakei und Polen. Auch das, so Nöllenburg, habe dazu beitragen, politische Debatten aus der Arbeit herauszuhalten.
Was den messbaren Output anlangt, haben die Gruppen erfolgreich gearbeitet. Nöllenburg hat ausgerechnet, dass jedes Vorhaben statistisch acht Publikationen überwiegend in Peer-reviewed Journals hatte. Und dass im Mittel fünf Doktorandinnen und Doktoranden bzw. Postdocs pro Projekt eingebunden waren, insgesamt 190 Nachwuchsforschende und Studierende in den drei Partnerländern.
Wie soll es weitergehen?
Und doch gibt es, trotz der erfolgreichen Bilanz, einen Wermutstropfen. Beim Statussymposium in Radebeul kam natürlich die Frage auf, was aus den trilateralen Partnerschaften werden soll, wenn die Förderung ausläuft? Allen war klar, dass kein anderer Förderer ukrainisch-russische Kooperationen finanzieren würde.
Vor diesem Hintergrund und unter dem Eindruck einer positiv ausgefallenen Evaluation entschloss sich das Kuratorium im November 2019, fünf Jahre nach der Erstauflage, zu einer zweiten, finalen Ausschreibung. Antragsberechtigt waren nur Projektgruppen, die bereits trilateral zusammengearbeitet hatten. "Die Stiftung wollte den erfolgreichen Kooperationen die Chance bieten, noch einmal durchzustarten und ihre Forschungen voranzutreiben", sagt Matthias Nöllenburg. 40 Anträge gingen bei der Stiftung ein, für 17 Vorhaben wurden rund fünf Mio. Euro an Fördermitteln bewilligt, vier zusätzliche Projekte befinden sich gegenwärtig noch in der Antragsprüfung.
Die Kämpfe in der Ostukraine gehen weiter. Die "Trilateralen Partnerschaften" auch. Letztmalig. Matthias Nöllenburg rechnet damit, dass bis Mitte 2023 das letzte deutsch-ukrainisch-russische Forschungsprojekt beendet sein wird. Und würde sich wünschen, dass bis dahin der Frieden in die Region zurückgekehrt ist – und mit ihr die Freiheit von Forschung und Lehre über die Grenzen hinweg.