Corona-Krise: Die Verantwortung von Wissenschaft und Medien
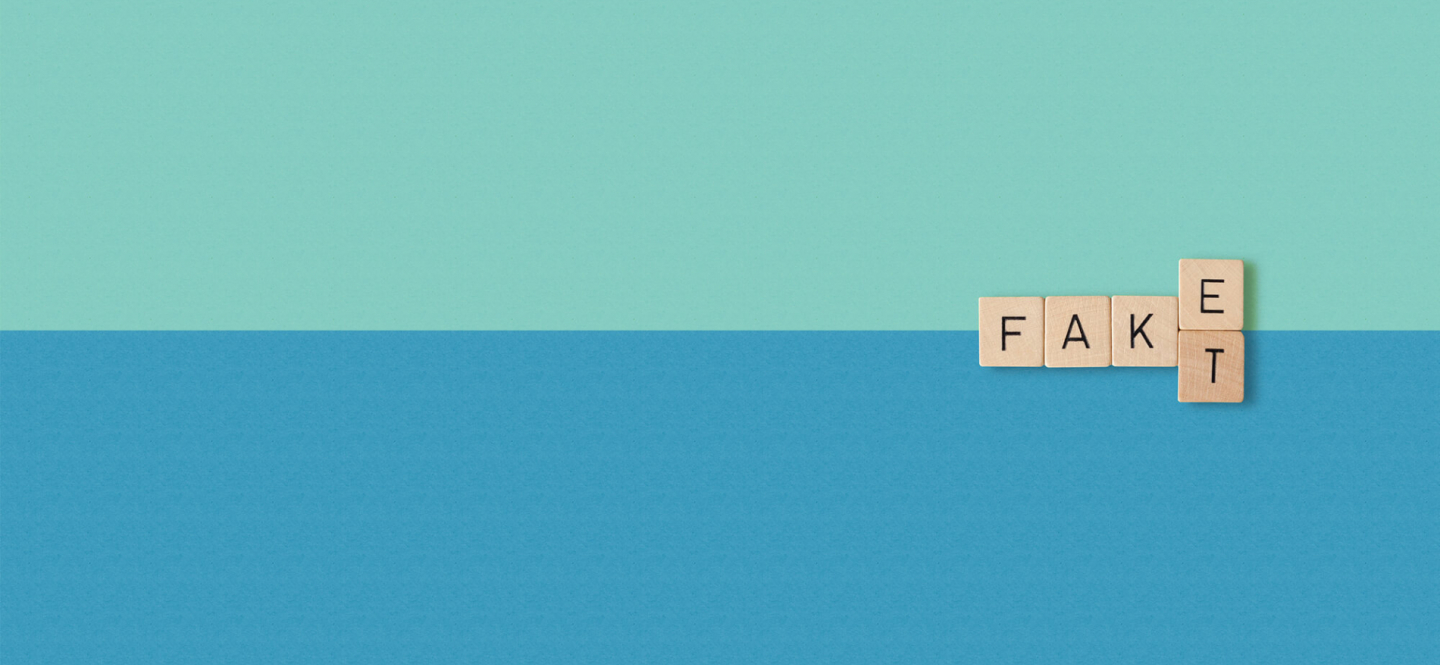
Werden Medien und Wissenschaft in der Pandemie ihrer Informationspflicht gegenüber der Gesellschaft gerecht? Georg Schütte, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, resümiert ein Gespräch mit Praktikerinnen und Praktikern, u. a. mit Christian Drosten.
"Werden Wissenschaft und Medien inmitten der Corona-Krise ihrer Informationsverantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht?" – Diese Frage diskutierte ich kürzlich in einem Video-Call mit fünf ausgewiesenen Expertinnen und Experten: Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Charité in Berlin; Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsautor für "Science"; Hendrik Brandt, Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung; Birte Fähnrich, Wissenschaftskommunikationsforscherin an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sowie Nicola Kuhrt, Medizinjournalistin, Vorständin der Wissenschafts-Pressekonferenz e.V. und Mitgründerin des wissenschaftsjournalistischen Startups MedWatch. Das Gespräch war der Auftakt zu einer dreiteiligen Video-Chat-Reihe, gemeinsam mit dem Berliner Büro des Wellcome Trust und der Stiftung Mercator.
Für mich war dieser Videotalk in vielerlei Hinsicht erhellend. Ich habe besser verstanden, wo das Trennende und das Verbindende zwischen den Logiken beider Teilsysteme liegt, zwischen Wissenschaft und Journalismus. Und mir wurde in aller Schärfe bewusst, dass es eines sehr viel entschiedeneren Engagements vieler Akteure bedarf – auch im System der Wissenschaft, der Förderer und der Politik –, um den qualitätsvollen, am Gemeinwohl orientierten (Wissenschafts-)Journalismus zukunftsfähig zu halten. Andernfalls würden wir endgültig verlieren, was jetzt schon vital bedroht ist: Eine Gesellschaft, deren Wissen und Handeln auf evidenzbasierter Information beruht, nicht auf manipulativen Meinungen und antiaufklärerischer Propaganda.

Zugegeben, die Eingangsfrage war so weit gefasst, dass ich nicht ernsthaft ein eindeutiges Ja oder Nein aus der Runde erwartet hatte. Ich selbst sehe, wenn man die mediale Repräsentation des Themas Covid-19 seit Mitte März 2020 Revue passieren lässt, Stärken und Schwächen, Themenkonjunkturen im Auf- und Abschwung. Es gibt Kritikerinnen und Kritiker der medialen Aufklärung, ebenso wie Fürsprechende. Konstatieren kann man aber getrost wohl Folgendes:
- Nie zuvor waren Fachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler so medienpräsent.
- Nie zuvor war das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Wissenschaft so groß wie im April (73 Prozent) und Mai 2020 (66 Prozent); das belegen die Umfragewerte im Wissenschaftsbarometer.
- So hoch wie lange nicht mehr war das Bedürfnis der Bevölkerung nach valider Information, was sich insbesondere durch Klickzahlenrekorde auf den Websites etablierter Medien niederschlug.
Auch die Politik hat einen guten Job gemacht.
Die Kommunikationsleistung von Wissenschaft und Medien seit dem März 2020 dürfte unbestritten großen Anteil an dieser positiven Momentaufnahme haben. Fairerweise muss man die Politik als dritte Akteurin hinzufügen. Auch sie hat einen guten Job gemacht.
Bis auf den heutigen Tag ergeben Umfragewerte, dass die meisten Menschen mit dem Krisenmanagement sehr zufrieden waren und der Politik ihr Vertrauen schenken – trotz eingeschränkter Freiheiten, noch nicht bezifferten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgeschäden und schrillen Demonstrationen von Kritikern und Skeptikern in Berlin und anderswo.
Dies also war der gesellschaftliche und politische Rahmen, in dem wir unsere Diskussion führten. Vereinbart hatten wir strikte Vertraulichkeit. Mit Zustimmung aller Beteiligten paraphrasiere ich im Folgenden aber einige Gesprächspassagen, die meines Erachtens wert sind, breiter geteilt zu werden – und vielleicht auch Zündstoff liefern für weitere Diskussionen? Zweieinhalb Stunden haben wir gesprochen. 50 eng geschriebene Typoskript-Seiten sind daraus entstanden. In vier Kapiteln finden Sie hier eine Reihe von Kerngedanken und Thesen aus dem Gespräch sowie persönliche Anmerkungen. Ich würde mich freuen, wenn sie zu Anknüpfungspunkten für weiteren Austausch würden – in der Scientific Community, unter Wissenschaftsförderern, in der Politik. Die Zeit, das ist mir klar geworden, drängt.
Wie kommunikationsfähig ist die Wissenschaft?
Dass das deutsche Wissenschaftssystem seinen selbst gesteckten Zielen auch 20 Jahre nach dem PUSH-Memorandum noch hinterherläuft, war in der Runde Konsens.
Der Dialog ... steckt immer noch in den Anfängen.
Der Dialog auf Augenhöhe mit einem außerwissenschaftlichen Publikum steckt immer noch in den Anfängen: "Es fehlt an Bereitschaft, es fehlt an Fähigkeiten und es fehlt auch an Fertigkeiten bei vielen deutschen Professorinnen und Professoren, ernsthaft und belastbar für das zu stehen, was sie sind und was sie können" (Perspektive aus dem Journalismus). Und es fehlt offenbar auch, zumal bei den Arrivierten, an konstruktiver Haltung: "Der Grund, dass ich weniger deutsche Wissenschaftler zitiere als welche aus anderen Ländern, hat sehr viel mit ihrer Zugänglichkeit zu tun." (Journalismus).
"Wissenschaftskommunikation in der Corona-Krise"
Hier finden Sie alle Beiträge zu den Diskussionsrunden von Stiftung Mercator, Wellcome Trust und VolkswagenStiftung.
Wissenschaftskommunikation kommt in der wissenschaftlichen Karrierebildung einfach nicht vor.
Nach wie vor honoriere das Reputationssystem kein Engagement in der Wissenschaftsvermittlung – anders als etwa in den USA, wo das Schreiben populärwissenschaftlicher Sachbücher zum Ansehen auch in Peer Groups beitrüge; "das passiert hier irgendwie nicht. Das ist in der deutschen Wissenschaftskultur nicht verankert." (Perspektive aus der Wissenschaft). Die meisten Professorinnen und Professoren sähen ihr Kommunikations-Soll ohnehin mit ihrem Deputat an Lehrveranstaltungen für Studierende abgegolten. Nach wie vor gibt es auch kein verpflichtendes Modul "Wissenschaftskommunikation" in den Curricula, wie PUSH es schon vor 20 Jahren vorsah. Wissenschaftskommunikation komme "in der wissenschaftlichen Karrierebildung einfach nicht vor" (Wissenschaft).
Zwar böten fast alle Universitäten und Forschungseinrichtungen Medientrainings. Aber das probeweise Formulieren einer Pressemitteilung zum eigenen Forschungsgegenstand würde Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht auf die Medienrealität vorbereiten. "Die DFG vergibt zwar den Communicator-Preis, fördert aber verständlicherweise keine Medienausbildung. Da gibt es eine Lücke." (Wissenschaft).
So kollidieren Forscherinnen und Forscher häufig völlig unvorbereitet mit der Logik des Mediengeschäfts: "Dass Medien Personen hochstilisieren, um sie später wirkungsvoll angreifen zu können, dass das ein klassisches Motiv ist, wusste ich vorher nicht (…). Kein Wissenschaftler ist darauf vorbereitet, dass mit ihm umgegangen wird wie mit einem Politiker." (Wissenschaft).
Die Medienlogik verlangt "Darsteller aus der Wissenschaft", die eloquent und telegen sind und das liefern, was die Wissenschaft kraft ihrer inneren Logik in der Regel gar nicht liefern kann: eindeutige Festlegungen und alltagstaugliche Empfehlungen, möglichst schlagzeilenträchtig formuliert. Mit dem Begriff "eminenzbasiert" wurde im Gespräch die Attitüde routinierter Medienstars aus der Wissenschaft ironisiert, die sich vor Kameras und Mikrofonen zu jedem aktuellen Sachverhalt äußern, von der jüngsten Forschung aber häufig keine Ahnung zu haben. Wissenschaftlich betrachtet handeln sie grob fahrlässig.
Christian Drosten wurde es im Videotalk als besonderes Verdienst ausgelegt, dass er in seinem enorm reichweitenstarken Podcast bei NDR Info seine persönlichen Unsicherheiten als Wissenschaftler klar offenlegt. So würden Zuhörerinnen und Zuhörer gleichsam live Ohrenzeugen bei der Entstehung wissenschaftlicher Erkenntnis – die am nächsten Tag, infolge neuen evidenzbasierten Wissens – schon wieder überholt sein kann.

Dr. Georg Schütte ist seit Januar 2020 Generalsekretär der VolkswagenStiftung und war zuvor Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Das Publikum muss die zugrundeliegenden wissenschaftlichen Prozesse verstehen.
In der Medienbranche, so hieß es in der Runde, werde schon seit Jahren kritisiert, der Wissenschaftsjournalismus sei zu sehr auf Ergebnisse fixiert, auf Nachrichten, die Aufsehen erregen im Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Dabei sei es genauso wichtig, dem Publikum die zugrundeliegenden wissenschaftlichen Prozesse zu erklären. Doch das geschehe in der Regel nicht: "Was ich persönlich deshalb an Drostens Podcast das Wichtigste finde, was langfristig vielleicht den größten Nutzen für die Bevölkerung hat, ist die Tatsache, dass Leute ein Verständnis dafür bekommen, wie ein Wissenschaftler Dinge einschätzt und wie Wissenschaft sich langsam an die Wahrheit herantastet und dass es eben nicht ein einziges Ergebnis gibt und das war's." (Journalismus). Hier sei vor allem die institutionelle Wissenschafts-PR in der Pflicht. Sie solle sich verstärkt an einer aufklärerischen, gemeinwohlorientierten Wissenschaftsvermittlung beteiligen statt vor allem Institutionen-PR zu betreiben. Auf diese Weise könnten der nachrichtengetriebene Journalismus und die hintergründig informierende Wissenschafts-PR sich gewissermaßen arbeitsteilig ergänzen und gemeinsam die Scientific Literacy ihrer Zielgruppen befördern.
Nie zuvor war die Nachfrage nach fundiertem Wissenschaftsjournalismus so groß wie gegenwärtig.
Hat der Wissenschaftsjournalismus ein Qualitätsproblem?
"Ich versuche seit vielen, vielen Jahren Volontäre oder Redakteure einzustellen, die einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Was wir an Bewerbungen kriegen, sind European Studies, Kommunikationswissenschaft rauf und runter, aber niemand, der etwas von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen versteht. (…) Ich glaube, im Journalismus müssen wir uns fragen: Wie kriegen wir Menschen, die mehr davon verstehen? Wie schaffen wir es, gemeinsam Bereitschaft, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu entwickeln, um über Wissenschaft zu sprechen, mit unseren Forscherinnen und Forschern vor Ort?" Dieser Stoßseufzer des einen Journalisten wurde von einem anderen ergänzt, der ein immer größer werdendes Nachwuchsproblem konstatierte. Journalismus werde immer unattraktiver wegen der wirtschaftlichen Perspektive, aber auch aufgrund der aktuellen Legitimationskrise in Teilen der Bevölkerung.
Ein paradoxes Phänomen: Nie zuvor war die Nachfrage nach fundiertem Wissenschaftsjournalismus so groß wie gegenwärtig. Und niemals, zumindest seit dem Boom in den 1980er Jahren, waren Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten in den Redaktionen so unterrepräsentiert wie heute.
Die Folge: Immer weniger Journalistinnen und Journalisten verfügen über die nötige Expertise, um ihre Rolle als vierte Gewalt angemessen auszuüben. Sie stehen der Flut neuer wissenschaftlicher Studien häufig hilflos gegenüber. Was davon ist relevant, was nicht? Wie reflektiert man Studieninhalte kritisch, wie ordnet man sie ein? Der immense Produktionsdruck, zumal im Online-Bereich, öffnet Hypes und Halbgarem Tür und Tor. Pressemitteilungen wandern immer öfter, kaum redigiert, in die Publikumsmedien. Es gibt niemanden, der sie kritisch hinterfragen oder in einen Forschungskontext einordnen könnte.
Wenn ein Thema Konjunktur hat und alle Medien der Republik die Universitäten und Forschungsinstitute mit Expertenanfragen stürmen, spült es auch Fachvertreterinnen und -vertreter aus der zweiten und der dritten Reihe ins Licht der Öffentlichkeit. Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die teils gar nicht, teils erst seit kurzem zu Drostens Thema arbeiten, diesem aber in Sachen Medienpräsenz hart auf den Fersen sind. Wie gelingt ihnen das? Weil diese auf jede Frage, egal welche, etwas zu antworten wissen: druck- bzw. sendereif, zugespitzt und darauf angelegt, Aufmerksamkeit zu erregen, u. a. indem Äußerungen von Drosten widersprochen werden und populäre Vorstellungen vorgetragen werden. Dies erfüllt die Formatanforderungen der Medien, vermittelt der Öffentlichkeit aber gewiss nicht den letzten Stand der Forschung. Medien bereiten mangels eigener Fachexpertise auch wenig qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Bühne – und handeln gegenüber der Öffentlichkeit grob fahrlässig. Das ist Medienlogik im fließenden Übergang zum Medienversagen. Und die Journalistinnen und Journalisten in der Runde waren sich dessen bewusst und würden dem Trend zum schleichenden Qualitätsverlust gern umkehren. Doch wie? Diese Frage blieb (noch) unbeantwortet.
Wem nützt die institutionelle Wissenschafts-PR?
"Als Journalist wünsche ich mir, man könnte auf die Universitäten einwirken, Wissenschaft nicht immer nur werblich darzustellen, sondern auch hintergründig, einordnend. Ich weiß nicht, ob das ein naiver Wunsch ist, aber das ist ja vielleicht auch mal erlaubt." Als die Diskussion auf die Rolle der Pressestellen in den Universitäten und Forschungseinrichtungen einschwenkte, kam Kritik vor allem aus der journalistischen Riege. Manche Kommunikationsverantwortliche würden den Zugang zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eher behindern als fördern. Manche kontrollierten, andere zensierten die Kontakte "ihrer" Wissenschaftler mit den Medien.
Zu viel Eigen-PR, zu wenig wissenschaftliche Faktenvermittlung.
Die Wissenschafts-Pressekonferenz e.V., der Interessenverband für Wissenschaftsjournalismus, hat im April 2020 in einem offenen Brief Behörden, Ämter, Universitäten und Forschungseinrichtungen aufgefordert, Journalistinnen und Journalisten bei der Informationsbeschaffung besser zu unterstützen. Ein Appell, der auf Seiten der Pressestellen großen Ärger ausgelöst hat. Dort arbeitete man wochenlang unter dem denkbar höchsten Druck und fand die Vorwürfe des Verbands ungerechtfertigt (taz-Artikel "120 Anfragen an einem Tag").
Zu viel Eigen-PR, zu wenig wissenschaftliche Faktenvermittlung war der Eindruck der meisten in der Runde. Eine Teilnehmerin immerhin kam den Pressestellen zur Hilfe und wies auf den Druck hin, den die Präsidien auf die ihnen unterstellten Kommunikationsabteilungen ausübten. Von dort heiße es: "Ja, wir müssen medial sichtbarer sein, damit wir gegenüber der Politik legitimieren können, dass wir diese finanziellen Mittel kriegen und damit wir dem kleinen Bürger um die Ecke auch sagen können, die Uni ist wichtig und Ihr müsst eure Steuern zahlen, damit wir das hier finanzieren können." Eine systemimmanente Problematik, sagte die Person, die sich kaum auflösen lasse (Wissenschaft).
Auch ich möchte zugunsten der institutionellen Wissenschafts-PR einen Hinweis geben: Ihre Vertreterinnen und Vertreter sind sich der Zielkonflikte ihres Handelns seit langem sehr bewusst. Bereits 2016 publizierten sie die vom eigenen Berufsverband initiierten "Leitlinien für gute Wissenschafts-PR", an deren Formulierung neben vielen Akteuren aus dem Wissenschaftssystem, u. a. die VolkswagenStiftung, auch Wissenschaftsjournalisten mitgewirkt haben. Das Problem: Wichtige Institutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft und Gremien wie die Hochschulrektorenkonferenz ignorieren das Dokument bis heute. Eine neue, aufklärerische Zielvorgabe für die Mission der zahlreichen, personell wie finanziell zumeist gut ausgestatteten PR-Abteilungen wird von den Entscheidern offenbar nicht gewünscht. Wieder eine vertane Chance, die Debatte über eine qualitativ verbesserte und gemeinwohlorientierte Wissenschaftskommunikation endlich breit zu führen.
Es fehlt bei vielen Akteuren ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie öffentliche Kommunikation heutzutage funktioniert.
Wie umgehen mit Wissenschaftsleugnern?
Es war, kaum verwunderlich, die Kommunikationswissenschaftlerin in der Runde, die uns darauf hinwies, dass auch unsere Debatte wie viele andere von einer längst überholten Vorstellung ausgehe, wonach die Welt zweigeteilt sei: Wissenschaft produziere Erkenntnis und Medien würden sie verbreiten, "und nebenan gibt es noch so ein bisschen Social Media-Rauschen."
In Wahrheit fehle bei vielen Akteuren "ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie öffentliche Kommunikation heutzutage funktioniert." Die Bedeutung der sozialen Kanäle werde unter-, die Medienkompetenz der Bevölkerung überschätzt, "weil Leute teilweise gar nicht mehr erkennen, wo Informationen herkommen, wie sicher die sind. Sind die journalistisch, sind die nicht journalistisch? Nicht nur ältere Kollegen, auch jüngere und sogar meine Studierenden haben häufig eine sehr reduzierte Vorstellung davon, wie unsere Netzwerköffentlichkeit heute funktioniert, (…) wie segmentiert sie ist." Neben den etablierten Medienkanälen und renommierten Forscherinnen und Forschern gebe es im Netz inzwischen eine schier unendliche Fülle "weiterer Experten, zum Beispiel von NGOs, aber auch Quasi-Experten, die kommunizieren ganz selbstverständlich über wissenschaftliche Themen, auch sehr hemdsärmelig, und sind aber ganz entscheidend dafür, wie Wissenschaft in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, (…) welches Vertrauen Wissenschaft im weitesten Sinne genießt." In puncto Präsenz und Wirkungsmacht, so der allgemeine Eindruck, habe die Wissenschaft ihren Kritikern im Netz nichts Wirkungsmächtiges entgegenzusetzen.

Wie kann sicher gestellt werden, dass statt Fake News Fakten bei den Menschen ankommen?
Aus dem journalistischen Lager kam Bekräftigung. Es gebe eine große Zahl von Menschen, die man über die etablierten Kanäle und im üblichen akademischen Habitus nicht erreiche. "Wissenschaft und Medien brauchen gleichermaßen neue Kommunikationsformen im Netz. Twitter und Facebook genügen schon lange nicht mehr. Wir müssen eigene digitale Formate für Wissenschaftsjournalismus entwickeln und wir brauchen viel, viel mehr Kompetenz für Social Media." (Journalismus)
Eine andere Person wusste zu berichten, in den USA sei das mediale Ökosystem bereits überschwemmt von "Bad Faith Actors, die überhaupt kein Interesse haben, die Realität irgendwie abzubilden." Ein Trend, von dem er nicht wisse, wie man ihn stoppt, "weil wir bis heute nicht verstehen, wie man Verschwörungstheorien als Journalist so widerlegt, dass sie sich dadurch nicht erst recht weiter im Netz verbreiten." Handlungsempfehlungen erwarte er sich da von der Kommunikationsforschung.
Fazit
Zum Schluss die übliche Frage: Was nun? Wie können wir in der VolkswagenStiftung Impulse aus der Diskussion in Förderhandeln ummünzen? Ich möchte hier erste Antworten in zwei Perspektiven versuchen: einer unmittelbaren und einer mittelfristigen.
Unmittelbar bevor steht der Blick auf die Anträge, die uns bis Anfang September 2020 in der Ausschreibung zur Etablierung von Zentren für Wissenschaftskommunikationsforschung erreicht haben. Hier war es von Anfang an unsere Intention, nicht allein zur Vermehrung akademischen Wissens beizutragen, naheliegenderweise in der Kommunikationsforschung. Nein, wer in dieser Ausschreibung eine Chance haben will, musste vor der Antragstellung ein breites Projektbündnis auf die Beine stellen: mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Fachwissenschaften, Partnern aus der Theorie und Praxis der Wissenschaftskommunikation (Forscherinnen und Forscher, Medienschaffende, NGOs, Museen etc.) und Expertise aus dem Ausland. Ich bin gespannt auf die Ideen, die uns in dieser Ausschreibung unterbreitet werden.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaftskommunikationsforschung steht im Fokus der Ausschreibung "Wissenschaftskommunikation hoch drei" der VolkswagenStiftung.
Ebenfalls kurzfristig werden wir die Ausrichtung der Medientrainings mit unserem Partner, dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik), diskutieren. Müssen wir unsere Geförderten, die diese Seminare absolvieren, noch besser vertraut machen mit der Logik des Mediensystems und ihnen durch Unterweisung mehr Know-how und Selbstsicherheit, aber auch eine konstruktive Haltung im Umgang mit Medien vermitteln? Und wie können sie selbst ihre Erfahrungen konstruktiv ins System zurückspielen, als Multiplikatoren?
Was noch? - Seit Ende September 2020 ist die VolkswagenStiftung Teil der vom BMBF initiierten #FactoryWisskomm. Hier werden wir uns, unter der Anleitung von Acatech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, sowohl in der Arbeitsgruppe zur Stärkung des digitalen Wissenschaftsjournalismus engagieren wie auch in der von der Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft Katja Becker geleiteten Arbeitsgruppe zur Wissenschaftskommunikationsforschung.
Und mittelfristig?
Wir werden prüfen, wie wir Forscherinnen und Forscher dabei unterstützen können, in den sozialen Netzwerken zu agieren. Hier könnte die Etablierung eines Austauschformats ein erster Schritt sein, um Praktikerinnen und Praktiker aus der Wissenschaft zusammenzubringen. In unserer Runde waren sich Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft wie des Journalismus gleichermaßen darin einig, dass in der Corona-Frühphase die besten Hinweise auf wissenschaftliche Arbeiten bei Twitter erhältlich waren. Unsere Diskussion hat klar erwiesen: So lange das Wissenschaftssystem die sozialen Medien als Verteiler für PR-Meldungen nutzt, so lange sind Sinn und Nutzen dieser Kanäle nicht verstanden.
Außerdem – auch das sei hier verraten – diskutieren wir mit dem Kuratorium und in den zuständigen Abteilungen in der Stiftung (Förderung, Veranstaltungen, Kommunikation) gerade sehr intensiv, welchen Raum das Spannungsfeld "Wissenschaft in der Gesellschaft" künftig im Förderhandeln der VolkswagenStiftung einnehmen soll. Dabei könnte die Ausschreibung zu den Zentren für Wissenschaftskommunikationsforschung zum Ausgangspunkt für weitere flankierende Maßnahmen werden.
Journalismus soll kritisch, unabhängig und streitbar sein. Und er soll es auch in Zukunft bleiben. In genau dieser Rolle bleibt er unverzichtbar. Das bringt ein O-Ton-Zitat treffend zum Ausdruck, das ich an das Ende meiner Rückschau stelle: "Wie schaffen wir eine Realität – Wissenschaft und Journalismus gemeinsam -, auf deren Grundlage wir in Deutschland bestimmte Veränderungsprozesse auch in den nächsten Jahren durchstehen? Wie schaffen wir dafür eine gemeinsame Grundlage, wo die Leute verstehen, worauf Diskussionen basieren? Dafür muss Verständnis geschaffen werden. Diese Annäherungsprozesse zwischen Wissenschaft und Journalismus sind, glaube ich, wahnsinnig wichtig."
